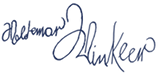Woldemar Winkler und Richard Heuer Viebach
Gestaltungsfreiheit

aus einem Doppelporträt neben
Woldemar Winkler, um 1929
Verbinden und bauen, der Bewegung Raum geben und neue Antriebe zuordnen und überordnen kann der Bildner mannigstfach, immer aber nach künstlerischen Grundsätzen, deren Feld immer wächst und deren Inhalt sich ständig erneuert und klärt.
Die Kunstgesetze bestimmen den Wert und geben der Freiheit Form und Dauer. Freiheit ganz ohne Form wäre schrankenlose Willkür, kein schirmender Wall gegen Entartung und Verflachung. Freiheit setzt schon ihrem Begriffe nach Bindung an Höheres voraus, um wieviel mehr ihrem Sein nach!
Freiheit liegt wie ein Ringwall um den fruchtbarsten Hochbezirk einer Ebene, läßt nach der Ebene hin nichts ausfallen, führt wallinnen jedoch zu Hochflug und Tiefendrang. Denn der Wall schließt zwar ringsum ab, nicht jedoch lotrecht hinauf und hinab. – Die Achse hinauf und hinab heißt: Verantwortlichkeit, mithin Zwang zur Emporführung und Gründung, zur Gestaltung und Rangordnung lebendiger Werte.
Der Bildner erzeugt in sich oder findet vor: Verbindungen, An- und Aufbautypen, von denen einige wenige ihm allgemach näher als viele andre liegen. Er bevorzuge sie um ihrer und seiner selbst.
Sie enthalten mitunter bestimmende Besonderheiten seines Wesens, Gefüges oder Baues, Antlitzzüge seiner Art. Sie bergen »das Gesetz, nach dem er angetreten« oder durch Erweitern, Steigern und Klären die Überwindung. Denn Form und Aufbau und vollends Form-Schlichtung und Läuterung sind Ausdruck eines stetigen wesensinneren Vorganges.
Sie künden den Zug zur Ordnung und Höherordnung, zum Aufstiege aus Niederungen und damit zur Erlösung aus den Fesseln der Engen und Minderwerte.
Wo ein Bildner zuweilen wähnen sollte, in letzter Form wie in einem Zelte gelandet zu sein, dort frohlocke er, wenn er gewahr wird, daß auch das Zelt nur Tunnel ist. Wahre Künstler sind obdachlos. Ihre Vorsehung und Vorsicht sei Rücksichtslosigkeit gegen sich. Bildner sein heißt: immer weitermüssen!
Welche Formen der Künstler aufgreifen, entwickeln und abstreifen wird, das wird seine Art und seinen Weg charakterisieren, seinen Typus und Wert als Mensch und Gestalter.
Woran seine Formen auftreten: an organischen oder anorganischen Gebilden, an chemischen oder mechanischen oder geistigen Vorgängen und so fort, das ist, als nur inhaltlich, als nur wichtig in anderer, als künstlerischer Bedeutung, für den Wert seines Gestaltens ganz gleichgültig.
Form muß ihre ganze künstlerische Geltung in sich tragen und sich im Bilde selbst auswirken, braucht's nirgends und nirgendwie außerhalb.
Ein Kreis im Bilde z. B. ist, wie alles im Bilde, rein bildmäßig aufzufassen: als Bild-Element – nicht etwa zugleich als Symbol für die Sonne oder die Gerechtigkeit und was dergleichen kunstäußere Bezüge mehr sein mögen.
Ein gleichseitiges Dreieck im Bilde ist ein Dreieck, das in reiner Anschauung zu messen ist und zu erfassen als Eigenwert und als Element im Bilde.
Es ist keineswegs ein zufällig einmal augenloses Symbol göttlicher Dreieinigkeit oder der Vorsehung. Solch bildäußerer Hinblick täte der Form Gewalt. Erlaubt dort, wo Symbole geschaffen werden, wäre er vor anderen Bildern unstatthaft, demnach wortwörtlich Un-Fug.
Dahin gehören, im Anschluß an begründete Urteile über Formgebietszugehörigkeit, Fehl-Forderungen an den durchgängig zu wahrenden Zugehörigkeits-Charakter.
Das besagt: der Bildner steht allenthalben unter den Gesetzen künstlerischer Fügung, nirgends unter den Gesetzen außerkünstlerischer Gestaltung, vielmehr überall darüber. Er braucht keinen Einklang mit ihnen zu beachten, nicht ihre Folgerichtigkeit zu suchen und so fort.
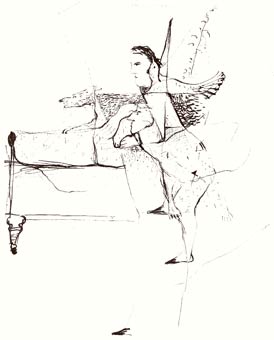
Er kann Gestalten, die offenbar der organischen Welt angehören, in einen anorganischen Bildvorgang einbeziehen, z. B. in den chemischen der Diffusion oder Diosmose: Die Körper mischen sich dann und fließen ineinander über. Ein im Ausmaße ungewöhnlicher, in der Seins-Stufe bereichswidriger Vorgang, dessen Gestaltphase jedoch außerordentlich kunstwert sein kann. – Durchgangsform, Hindurchform, Perform, chemisch: Endosmose, Exosmose etc.
Gegen die Zeit: Er darf einen Körper in aufrechter Stellung festhalten, zugleich, etwa von der Körpermitte, von irgendeiner Beugungsmitte ab, vor- oder zurückgeneigt, vor- und/oder zurückgeneigt.
Gegen die Schwere: Körper, die gewohnterweise nicht schweben, z. B. Koffer, dürfen im Bilde sehr wohl schweben. Dome dürfen in den Wolken stehen. Eine Hand, nur eine Hand, darf in Übermannshöhe auf eine Wand schreiben.
Gegen Flüssigkeit und Staue: Wasser darf gemalt werden: mittenauseinandergeschieden und voneinandergerückt, als wäre es zersägtes Eis. – Ein Baum darf zerfließen.
Gegen Organ- und Feuernatur: Drei Männer dürfen sich in einem feurigen Ofen ganz wohl-fühlen. Ein Prophet darf mit feuriger Zunge sprechen, ein Leu oder Greif damit blecken.
Gegen Organ-Zahl: Ein Mensch darf drei Augen haben oder nur eins oder gar keins, dafür 100 Arme. Ein Januskopf ist »erlaubt«. – Der tschechische Löwe darf sich zweier Schwanzenden erfreuen, der österreichische Adler zweier Köpfe, auch ohne Symbol-Begründung. Und so vieles mehr noch unter allen möglichen.
Namen
Der Bildner darf aus organischen Formen und technischen Anlagen, z. B. aus zwei Fäusten mit Zügeln und aus Stromleitungsmasten samt Drähten und Isolierglocken, ein Ganzes malen, das keinem Direktor einer Überlandzentrale »gegen sein Gemüt« gehen wird.
Er darf aus einer Radnabe oder aus einem Strudel eine Kaffeemühle herausstürzen lassen, darf eine organische Form architektonisch und zugleich technisch aufbauen, die Bildgestalt eines Menschen oder Elefanten oder Pfauen z. B. aus würfligen Einheiten und Rädern.
Er darf eine organische Form, z. B. einen Flügel kristallisch erwachsen lassen, darf einer ägyptischen Grabpyramide die Fittiche des Schwanes leihen oder den Reiz einer klimatisch ungewöhnlichen Eisblumenlandschaft.
Er darf Felsen durchleuchten und Licht in Säcke füllen, Heere durch die Luft reiten lassen und unter Umkehr natürlicher Größenverhältnisse Liebende in Umarmung im Kelche einer Blume malen.Ein Mensch darf ein Zellgewebe durchwandern, ein anderer graphische Kurven durchklettern.
Scherz: – Rohrsystem – gefiedertes Zwerghuhn. Pinguine im Knochensturm. -Vergletschertes Noten-System. – Vulkan im Mischgemüse. – Schlangenfarm im Uhrwerk.
Expreßzug im Rückenmark. – Gaslaternen beschleichen eine Tomate. – Galopp schwarzer Hengste durch ein Eidotter. – Drei grünliche Juden in den Grotten eines Steppenbrands im Bazillenreiche, und so fort wären scherzhafte Titel zu Gemälden, in denen das oder jenes in eigenartigem Situationsanscheine auftaucht. Situationsbesonderheit ist kein Kunstwert, nie gegenständlich zu deuten, nur formal und farbig zu werten.
Der Maler darf Fische quadratisch oder zu einem T oder anders ordnen, was unter Fischen kaum je zum guten Tone werden dürfte; er darf Menschen zu Trauben oder Dolden vereinen, Pferde zu Spiralen und anderen Unbequemlichkeiten und kann damit hohe künstlerische Wirkung gewinnen.
Er darf Alles, solange er damit innerhalb künstlerischer Gesetze bleibt. – Natürlichkeit, Wahrscheinlichkeit, Behaglichkeit usw., das und anderes hat über sein Gestalten keine Macht.
Also wunderbar und fabelhaft, besonders und märchenhaft-verbunden darf Formwelt sein. Wunder und Märchen sind selber ja Hochgebilde der Kunst und bei aller Freiheit künstlerischem Gesetze unterworfen. Der Bildner darf alldem weithin folgen, nicht, um Eigenart, Einzigartigkeit, Wunder und Phantasma zu verkrampfen, sondern der Gestaltung zuliebe.

Je abstrakter der Künstler schafft, nur mit Gegenstandsform-Elementen und Verbindungen im Dienste reiner Kunstform,
Je mehr Abbildgehalt oder nur Abbildschein, gleichviel!, umso näher der Verdacht, der Bildner wolle im Sinne eines rohen Massengeschmackes, des Kunstmobs und Kunstsnobs, originell sein, statt den Besten aller Zeiten genug und sich selber immer wieder nie genug.
Wer schärfere Trennung sucht, kann unterscheiden: künstlich und ähnlich gelagert: absonderlich, wunderlich kunstfertig bewundernswert künstlerisch gesondert, besonders, wunderbar, vollsam
Das Wunderbare ist ein z. T. technisch begrenzter Begriff, wird von der Technik oft eingeholt und überholt, ist aber noch anderen Wandlungen, von anderen Bezirken des Lebens her unterworfen.
Der Künstler soll schaffen aus der Unteilbarkeit seines ganzen Seins heraus. Unteilbarkeit, übergegangen ins Bild, bedeutet nicht Unsiebbarkeit des Erzeugnisses. Das Unteilbare ist durchaus siebbar. – An eine mechanische Teilbarkeit ist dabei nicht zu denken.